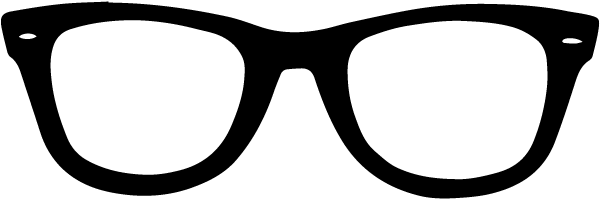Frustression?
Die Literatur beschreibt die Frustration als das Durchleben eines unfreiwilligen Verzichts. Wünsche werden nicht erfüllt, Erwartungen nicht bedient. Die Wissenschaft grenzt die Frustration als situatives, zeitlich fassbares Empfinden ab gegenüber der Depression, die als tiefer verankerte psychische Erkrankung bezeichnet wird. Gegenwärtig scheinen wir allerdings mit der schlichtbinären Einordnung nicht weiterzukommen.
Die Kommentarstränge in den sozialen Medien und explizit auf Facebook offenbaren verhältnismäßig unaufwändig, was seriöse Untersuchungen vom persönlichen Gespräch bis hin zu den überkommenen Experimenten an Laborratten kaum zu verdeutlichen vermochten: die Grenzen zwischen der simplen Frustration und psychischen Erkrankungen sind fließend. Und das in der Regel, ohne dass es den Betroffenen jemals bewusst wäre, da sie schon der Begabung zur Reflektion der eigenen Verhaltensauffälligkeiten entbehren. Von was reden wir also? Frustression?
Das menschliche Gehirn leistet manch Großartiges. Und das von den meisten völlig unbemerkt: die Frustressiven beispielsweise erleben ihre soziale Dysfunktion vermehrt als Ausdruck ihrer gerechten Empörung. In der offenkundigen Unfähigkeit, Verhältnisse sinnhaft einordnen zu können im Spannungsbogen von Sachunkenntnis, Ironieblindheit, hirnorganischem und/oder pathologischem Setup, werden diese im schlichten Korsett des eigenen kleinen Karos als Universalaufsicht erlebt. Und die Annahme der Gültigkeit der subjektiv schlichten Weltenbetrachtung wird noch sekundiert durch das Herbeieilen von likenden bis im Kanon mitblökenden Gefährten wie im Sturm der Menschenfresser auf Jerusalem in „World War Z“, allesamt mit der gleichen Diagnose, mehr oder weniger komplexe Sachverhalte in ihre einfachen Raster zu zwängen, als wollten sie die Fertigstellung eines vielteiligen Puzzles mit der Nagelschere beschleunigen. Das Ergebnis ist so oder so ein surreales Motiv.
Kurzschlussstatements, pampige Kindergartenrhetorik, stumpfe Beleidigungen ohne jede Finesse, dümmliche Besserwissereien, frei von jeder Eleganz und Eloquenz und absurdes Maßnehmen knapp über der Grasnarbe in Bezug zu den eigenen Standards. Mit „früher war …“ kündigen sich viele Auswürfe an, wie das Bäuerchen das Köttern, „gehört sich nicht“ und natürlich „die Ampel muss weg“, das so zuverlässig erklingt wie einst das „ceterum censeo cartahginem esse delendam“ durch Cato, den Älteren nach jeder Sitzung des römischen Senats: „im übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss.“
Die Frustressiven wissen schon alles und haben zu allem eine Meinung, völlig egal ob sie überhaupt ahnen oder verstehen, worum es eigentlich geht. Jede, noch so fürsorgliche Bitte um Unterlassung des Eigen-Outings zerebraler Vollentkernung wird unterlaufen mit dem empörten Verdacht, „man dürfe nichts mehr sagen.“ „Besser wärs“, möchte man rufen: „besser wäre es!“
„Hallo! Dollard, Miller, Barker und Maier hatten doch alle irgendwie recht mit ihren anachronistischen „Frustrations-Aggressions-Hypothesen“, die als überkommen galten und allesamt darin gleichen, dass ein Erleben von Frustration die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens skaliere. Auf das Versagen von Wunsch und Erwartung folgen die Verstimmung, ein verbaler oder tätlicher Angriff. Die Details sind leicht zu googeln und nachzulesen.
Ob mein Text so richtig ernst gemeint ist? Natürlich nicht. Auch wenn sich der eine oder andere Verdacht zunehmend zu erhärten scheint. Schließlich verstehe ich mich im Gegensatz zu vielen Diskutanten eher selten als Experte und staune regelmäßig nicht schlecht über manches „profunde“ Fazit, das immer häufiger mit einem in Versalien ausgeschriebenen „PUNKT“ und dem inflationäre Einsatz von Ausrufezeichen zementiert werden will. Hilfe! Bitte hört auf!
Je länger ich mich mit diesen Phänomenen beschäftige, desto klarer wird mir: „scio nescio“ - ich weiß, dass ich nichts weiß und ich sehne mich nach einer inneren Emigration.