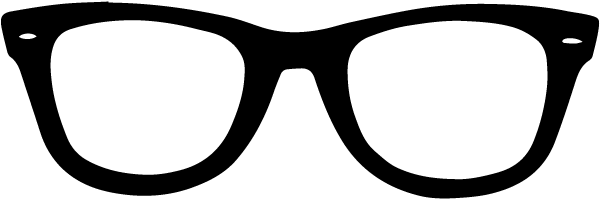„Erbärmlich“.
Es ist wieder da.
„Ja, teurer Freund, du hast sehr recht,
Die Welt ist ganz erbärmlich schlecht,
Ein jeder Mensch ein Bösewicht,
nur du selbst natürlich nicht.“
Das Adjektiv „erbärmlich“ hat eine erstaunliche Sinnbreite, die zwischen Mitgefühl und Verachtung oszilliert. „Erbärmlich“ leitet sich ab von „barmen“, einem altmodisches Wort, das bedeuten kann, mit Mitleid erfüllt zu werden, oder aber auch, sich im Lamento zu ergehen und weinerlich zu klagen.
„Erbärmlich“ roch schon fast ein bisschen nach „alter Mann unterm Arm“, etwa da, wo sich bei manchem lieben Großvater engagementbedingt einst ein dauerhafter Hinweis auf die Blutgruppe befand und war bereits ziemlich aus der Mode gekommen. Doch jetzt ist es wieder da und in den sozialen Medien als schnappreflexter Vorwurf erstaunlich prominent. Wie konnte das passieren?
Das liegt vermutlich an seinem Freisler-Faktor, dem rhetorischen Höchstmaß auf der Verachtungsskala. Noch deutlicher als „rotgrünversifft“. Sprecht „erbärmlich“ ruhig mal so aus, wie es Oliver Masucci zum Casting seiner bislang größten Rolle als Führer vorgetragen hätte oder Bruno Ganz in seinem „Bonkerrr“: „errrbärrmlich!“ Jeder, der noch irgendetwas merkt, spürt es augenblicklich: den klanggewordenen Ausdruck moralischer Selbstüberhöhung in pathologischem Wahn.
Wer anderen Erbärmlichkeit vorwirft, stellt sich wie selbstverständlich über diese, ohne sich erst lange mit Selbstzweifeln zu plagen: „Herrenmenschenfeeling 4 Dummies“.
„Erbärmlich!“ Das kommt wie hingerotzt, plump aufgestanpft und möchte sich gerne alle Widerrede verbitten. Ein Fanal selbstbesoffener Blödheit. Niedlich. Durchsichtig. Eindeutig. Die Dummheit hat aufgehört sich zu schämen. Traurig und fatal zugleich.
Brigitte und Frank Mustermann verachten gerne. Für sie ist alles „erbärmlich“, was ihr schmales, bildungsfeindliches Karo sprengt. „Erbärmlich“ ist so etwas, wie eine adjektivgewordene Satzzeicheninflation derjenigen, die beim Denken nicht immer viel Glück haben.
Ein Indikator. Man riecht bereits nach nur einem Wort, wohin die Krrraft-durch-Freude-Reise geht. Ins Blaune. Gedanklich und eigentlich das gerade nicht. Wie auch und wohin.
»Du bist erbärmlich, du bist nichts«, sprach der Gedanke zum Einfall. Dieser erwiderte: »Ich möchte wissen, ob du dich irgendwo einfinden kannst, wo ich nicht früher gewesen bin« (Marie von Ebner-Eschenbach).
„Dem erbärmlichen Geist ist es zu eigen, stets nur Klischees und niemals eigene Einfälle zu verwenden.“
Das stammt von Hieronymus Bosch und weist die regelmäßige Nutzung der sinnleeren Worthülse als einschlägigen Eigenbeleg aus.