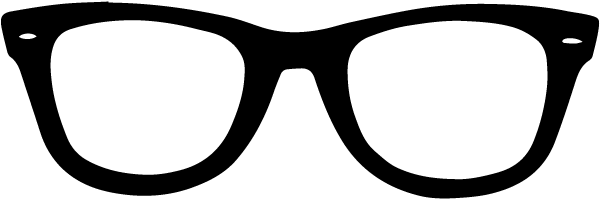„FLOTT!“
Kennt Ihr das? Besondere Worte oder Wortfolgen als Zeichen von Verbindung zu besonderen Personen? Ihre Verwendung zum Beleg von Sympathien und Antipathien in der Gegenwart, aber auch als erinnerndes Ritual. Zitierend, imitierend, wertschätzend, respektierend, plagiierend, nachäffend, diffamierend, despektierlich?
Und weil ja immer so viel gemault wird in diesem Internetz und ich es gerade wieder etwas häufiger platziere, ziehe ich jetzt mal etwas ziemlich Positives aus dem Zylinder: das zauberschöne Wörtchen „flott“, als Adjektiv wie Adverb gleichermaßen wunderbar, vielleicht ein bisschen omihaft, aus meinem persönlichen Sammelsurium und dessen Ablage für unregelmäßig genutzte, aber immer wiederkehrende Vokabeln.
Positiv, Komparativ, Superlativ: flott, flotter, am flottesten. Die Kompendien kennen durch die Bank vier Bedeutungen:“mit hoher Geschwindigkeit“, „modisch schick und lässig“, „von leichter, unbeschwerter, nicht ganz konventioneller Haltung“
oder bei Schiffen: „bewegungsfähig, nicht festliegend“. Und sie unterschlagen uns dabei noch so schöne Kombinationen, wie den „flotten Otto“, als volkstümliche Lautmalerei für eine Diarrhoe. Jetzt hätte ich beinahe „handfest“ geschrieben, aber genau das passt ja sinnstiftend eher weniger. Scheißegal.
Für mich selbst ist „flott“ onomatopoetisch. Möglicherweise nicht augenblicklich augenscheinlich und gelesen, aber spätestens dann, wenn das Wort leicht und flüchtig von der Zunge geht wie ein flachgelutschter Drops. „Flott“ spricht sich toll. Los, gleich nochmal: „flott“! Zu sprechen fast noch schöner als zu hören: „flott“ ... fff-l-ott.
Etymologisch kommen wir zu „Flotte oder Floß“ aus der Seemannssprache, im Mittelniederdeutschen „an vlot bringen“, also „fahrbereit machen“, im Niederländischen „vlot“ für „schwimmfähig“, jünger niederdeutsch „flot“ für „schwimmend, fließend“. Im 17. Jahrhundert hat „flott“ das Hochdeutsche erreicht und in der Studentensprache mutierte es vom ursprünglichen Sinn „obenauf schwimmend“ zum übertragenen Sinn „lebensfroh, munter“ mit allgemeiner Verbreitung im 18. Jahrhundert und wieder in der Jugendsprache der 1960er Jahre. Es ist doch wahrhaftig interessant, wie wirkmächtig sich die assoziative Kraft von „Analogien“ durchzusetzen vermochte und vermag als „das Herz des Denkens“. Letzteres lässt sich nachlesen bei Douglas Hofstadter und Emmanuel Sander unter demselben Titel.
„Flott steht für Schnellboote, nicht für Fregatten, scheiß auf die Nautik.“
Mich selbst verbindet die Verwendung mit meiner Großmutter Alwine, Jahrgang 1894 und 1976 zweiundachtzigjährig, dabei ledig verstorben als lange berentete Lehrerin, die sich selbst ganz und gar nicht mit „flott“ umschreiben ließ, die den Begriff dafür aber umso lieber zur mehrdeutigen Deklaration Dritter nutzte. Immer wenn ich Worte wie „flott“ ausspreche, habe ich sie stets in liebevoller Erinnerung, vor meinem geistigen Auge. Fast fünfzig Jahre nach ihrem Ableben. Beachtlich, wie man durch Sprache geprägt wird und was Sprache mit einem macht, oder? „Begriff“ selbst ist übrigens auch so ein Klassewort, etwas inhaltlich greifen zu können.
Alwine jedenfalls befand Fräuleins als „flott“, wenn diese bleierne Konventionen ignorierten für ein leichteres, positiveres und schöneres Leben mit mehr Gefühl für das eigene Sein im „hier und jetzt“. „Den Fahrtwind genießen“. Diese Metapher trifft es wohl ganz gut und Alwine meinte das durchaus positiv, wenn sie sich auch selbst dabei ein wenig im Weg stand, was der Zeit, der Not und ihrem Beruf geschuldet sein mochte.
Unkonventionell war sie allerdings ganz unbedingt. Als selbständig denkende und handelnde Frau, die das Leben für sich verdammt gut meisterte und sich auch nicht durch selbstvermeintlich Wohlmeinende beirren ließ. Ein Freigeist mit ausladender Bibliothek.
Als ich vier wurde, brachte sie mir die Uhr bei und wie man Mirabellen und anderes Obst aus dem eigenen Garten einmacht. Ein Jahr später dann das Lesen und Schreiben, weil sie Angst hatte, sie könne das möglicherweise nicht mehr erleben, wenn sie sich auf andere verließe. Mir bescherte das einen sedierenden Start ins Schülerdasein und erste Verwunderung über den recht unterschiedlichen Anspruch an Bildung in den verschiedenen Elternhäusern. Und spotten konnte sie. Wie eine Große.
Danke für alles.
PS: … und dann war flott zwischen „ein bisschen“ und „ziemlich“ ja auch noch ein zart umschreibender Gradmesser zur Bezeichnung der Promiskuität der fokussierten Delinquentin. Das habe ich allerdings erst später verstanden.