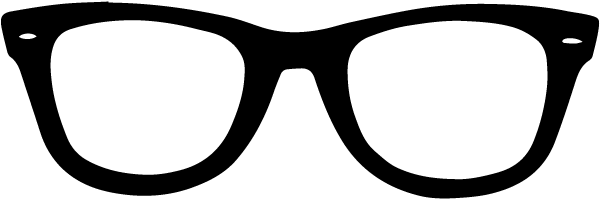Über Kreativität.
Was zur Hölle hat das französische Geschlecht einer Waschmaschine mit der Prostata, Venedig, Stalin, Hausfrauenerotik, Rick Rubin, der Volkshochschule und künstlicher Intelligenz zu tun?
Irgendwann in der vorletzten Nacht, womöglich so gegen vier in aller Früh, spülte es dem schlaflosen mir ein Meme in den Newsfeed. So früh wach, weil ich nach meinem Lazarettaufenthalt in der letzten Woche noch keinen guten, wirklich erholsamen Schlafrhythmus gefunden habe und natürlich weil wir alten, dicken, weissen CIS-Heten nachts halt auch mal raus müssen, um „den Harn abzuschlagen“, oder um es etwas rustikaler auszudrücken, zu „brunzen“, was vom mittelhochdeutschen Wort brunnezen stammt. Brunzen also, das von brunnen mit dem Suffix -zen abgeleitet ist, bedeutete demnach ursprünglich „einen Brunnen machen“. Was für eine zauberhaft zarte Analogie.
Faszinierend wie aus Bildern Worte werden und aus Worten Bilder, hin und retour.
Was war das also mit dem Meme? Eines jener inflationären Klassiker, das historische Gemälde und seine absurde „Neuvertonung“. Wort-Bildschere. Einer der zahllosen armen Poeten des 19. Jahrhunders, der sich den göttlichen Funken auf seiner Stirn herbeizureiben trachtet, frisch betextet: „Me during my French exam wondering what is the gender of a washing machine“.
Nicht schlecht. Ob das besser geht? Keine Ahnung. Möglicherweise. Aber heute nicht, jedenfalls nicht hier, denn ich interessiere mich erstmal für den Urheber des Schinkens. Möglicherweise weil ich mich frage, warum der sich mit so vielen Kollegen durch ein derart müdes Steretyp quälen muss. Leonid Osipovich Pasternak heisst der Künstler. Pasternak ist als Name nicht eben gängig und doch allgegenwärtig. Er war also der Vater von Boris. Ganz genau, dem „Doktor Schiwago“. Manche erinnern sich vielleicht an die Verfilmung des Stoffs und Julie Christie in der Rolle der Latissa Antipowa, alle aber an den glutäugigen Omar Sharif, der erfolgreichsten Großmutter im Filmgeschäft, der eigentlich Ägypter war mit libanesisch-syrischem Background als Dr. Juri Schiwago, wenn er nicht gerade als Sherif Ali Ibn El Kharisch mit Kumpel Lawrence o'Toole durch die Wüsten Arabiens zog.
Glutäugig und Doktor also. Aha, da liefen nicht nur die Tränchen der deutschen Hausfrau, während die sich im Fieberwahn an harten Gegenständen in Verzückung halluzinierte.
Dem Autoren Boris Pasternak wurde 1958 für sein Schaffen der Nobelpreis für Literatur angedient. Ein Schwergewicht. Auch fünf Jahre nachdem der Georgier Josef Wissarionowitsch Stalin die Sovjetunion von seiner eigenen Last durch sein spontan genommenes, persönliches Recht auf Ableben befreit hatte, war die Nation politisch noch nicht bereit, eine solche Ehrung durch den vermeintlichen Gegner auszuhalten. Dabei war das kleine Schweden seit den napoleonischen Kriegen neutral bis ins Jahr 2002. Was nicht mein Freund ist, ist mein Feind.
Schluss mit der geistigen Vagabundiererei, zurück an den Schinken und zu Leonid Osipovich Pasternak, der von Geburt Yitzhok-Leib genannt wurde, oder bereits entschärft, Isaak Iosifovich Pasternak. Bezeichnend. Pasternak senior lebte vom 3. April 1862 bis zum 31. Mai 1945, wurde demnach für seine Epoche biblische dreiundachtzig Jahre alt und hat also sowohl die Revolution, als auch beide Weltkriege überstanden. Als Maler.
Die Familie Pasternak reklamierte für sich, in direkter Linie von Don Isaak ben Juda Abrabanel abzustammen, einem berühmten portugiesischen jüdischen Philisophen aus dem 15. Jahrhundert, Politiker und Finanzier sowohl der Könige von Portugal und Kastilien, als auch der Vizekönige von Neapel und der Dogen von Venedig. Umtriebig, vielseitig, ein einflussreicher Drahtzieher.
Einen Beweis dafür gibt es nicht, wer will schon so kleinlich sein, und so beginnt Leonid Pasternaks belegbare Geschichte erst als sechstes Kind eines orthodoxen Herbergsvaters in einem etwas abgewirtschafteten Gasthaus in Odessa am schwarzen Meer.
Er studierte, nach Ausflügen in die Medizin und die Rechtswissenschaften, Kunst in Moskau und München und wurde nach zwei Jahren Wehrpflicht in einem russischen Artillerieregiment ziemlich schnell szenebekannt, um sich als erster russischer Maler selbst den Impressionisten zuzurechnen.
Warum ich das alles aufschreibe? Weil ich das verdamnt viel Biographie finde für so ein Genreding wie den verzweifelten Künstler vor dem weissen Blatt. Dem „weinenden Clown“ und der „feurigen Esmeralda“, einem Wandtattoo seiner Zeit:
„The torture of creative work“ - mit dem banalen Titel schleimte sich Pasternak an den Betrachter gefallsüchtig heran und beeindruckt damit die wohl eher Schlichten, die sich gerne von der stereotypen Geste einlullen und hijacken lassen. Ist es eigentlich genau diese harmlose Banalität, die das Ding zur Steilvorlage für den Meme-Remix macht? Ein Elfmeter bergab und ohne Torwart? Wahrscheinlich.
Brigitte und Frank Mustermann schauen, lachen, leben weiter. Sie fressen und verdauen die Szene mit dem weissen Blatt wie ihr abendliches Wurstbrot. Was auch sonst, denn ihr eigenes Maß an Kreativität beschränkt sich auf Muttis Dekorationswut im heimischen Biotop und seine auf die Wahl des abendlichen Fernsehprogramms. Ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. Es ist allerdings auch nicht schön. Nan muss das nicht verklären.
Viel spannender ist es jedenfalls, sich mal mit den zahllosen Kreativitätstheorien und ihren -techniken zu beschäftigen.
Das Wörterbuch spuckt für Kreativität in bildungssprachlicher Übersetzung „schöpferische Kraft“ aus und in der sprachwissenschaftlichen eine
mit der sprachlichen Kompetenz verbundene Fähigkeit, neue, nie gehörte Sätze zu bilden und zu verstehen.
Höre ich da etwa des Sprachphilosophen Wilhelm von Humboldts „Unendlichen Gebrauch von endlichen Mitteln“?
Oder Noam Chomsky, der ergänzt, wahre Intelligenz zeige sich darin, auch „unwahrscheinliche, aber erkenntnisreiche Dinge zu denken“ und das auch noch kausal zu erklären, Was den Menschen übrigens von der Maschine unterscheide, also der KI unserer Tage wie Chat GPT und dessen Verwandte Sidney oder Bard, die letztlich eben doch nur wiederkäut, weil sie es nicht besser lernen durfte.
Und was hat das jetzt mit dem weissen Blatt auf dem Bild vom ollen Pasternak zu tun? Vielleicht, dass wahre Kreativität und die Unfähigkeit, etwas auf den Weg zu bringen, diametral widersprüchlich sind.
Echte, tiefe Kreativität muss man nicht erzwingen. Und man hofft auch nicht darauf, beim Scheißen vom Blitz erschlagen zu werden. Sie ist da und sie fließt. Wenn man sie lässt. Das kann und sollte man trainieren. Man braucht dazu allerdings keine Leitfäden oder eitle Selbstschauen wie das Werk von Rick Rubin: „kreativ - die Kunst zu sein“. Keine VHS-Kurse und keine Persönlichkeitstest in der Brigitte.
Die Geste selbst ist Attitüde. Klischee. Effekthascherei. Gefälligkeitsspreizung für die Unbeleckten. Die Ursache für kreative Ladehemmung liegt jedenfalls nicht in deren tatsächlichen Abwesenheit. Man muss sie nicht herauslassen, befreien, lösen. Man kann aber aufhören, sie regelmäßig auszubremsen.
Guten Morgen