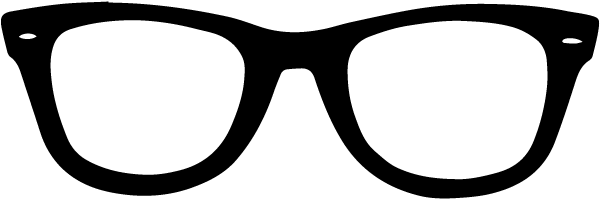Warum ich Bristol liebe.
Immer wenn ich als Knabe von vielleicht 12, 13 oder 14 Jahren in den Ferien meine Tante Inge, die mit dem „Queen Mary“-Ferrari als „Daily Driver“, und meinen schmerzfreien Onkel Harald besuchen durfte, um dort ein paar sehr entspannte Tage in grenzenloser Verhaltensfreiheit zu verbringen (O-Ton meiner Tante, der ehemaligen Schrottplatzkönigin von Duisburch Hafen: „Ihr habt Urlaub … ich auch. Will jemand 'ne Fluppe?“), blätterte ich durch die fantastischen Autoheftchen und den Autokatalog. Hängengeblieben bin ich darin regelmäßig an solchen Buden wie eben „Bristol“, gegen die ein Aston Martin, ein Morgan oder selbst ein Jensen Interceptor nahezu inflationär den allgemeinen Straßenverkehr fluteten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Auto schön fand, oder exotisch oder schön, weil exotisch. Ein einziges Mal erlebte ich einen Bristol in freier Wildbahn. Viel später, in den Neunzigern, während eines Londonaufenthaltes. Und ich war tatsächlich spontanverliebt. Großartige Handwerkskunst. Individualität im Extrem. Leider absolut jenseits meiner Portokasse. Egal, immer wieder, wenn dieses Einhorn in den sozialen Medien auftaucht, denke ich an glückliche Sommer in absoluter Regellosigkeit, dass es meiner Mutter die Haare zu Berge hätte stehen lassen, wenn ich ihr davon berichtet hätte. Habe ich natürlich nicht. Ich war ja nicht verrückt: „Tschö Tante Inge, bis zum nächsten Mal.“