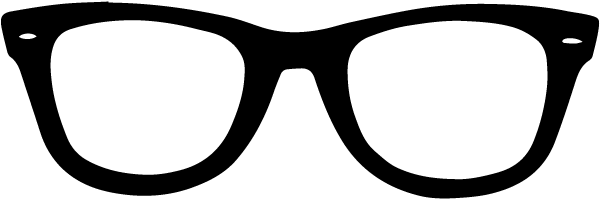Haben oder nicht haben?
Gedanken zu Besitz und was das mit mir macht.
Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich das Gefühl habe, mehr zu haben als ich brauche. Vielleicht sogar mehr zu haben als ich tatsächlich haben will. Und das ist mehr als nur eine zeitgeistige Konsumschwäche oder eine banale Mode der Selbstoptimierung. Ich kann das auch nicht genauer quantifizieren, so wie diese lustige Sekte, die sich mit nur hundert Sachen zufriedengeben wollen, sich aber noch streiten, ob der Begriff „Socken“ eine Sache sei oder doch eben jeder einzelne. Und das auch nur, bis der Trend schnell wieder vorüber ist.
Eine Menge Statisten meiner Alterskohorte träumen weiter, je nach Portemonnaie, von Old- und Youngtimern als Zweit- und Drittwagen oder gleich als ambitionierte Sammlung, von sündteuren Fahrrädern nebst quietschbuntem, werbegepflastertem Ganzkörperkondom à la Tour de France oder aberwitzig aufwendig personalisierten Motorrädern und „Born-to-be-Wild“-Lederjacken für den reifen, rundlichen Zahnarzt mit erektiler Dysfunktion, exotischen Reisen, voluminöseren Immobilien, Ferienhäusern, Booten ... allesamt verursachen ein gewaltiges Engagement. Allein die Vorstellung davon bereitet mir ein gewaltiges Unwohlsein, lässt mir Pickel unter den Fingernägeln gedeihen und Haare auf den Fußsohlen wachsen.
Reisen auch? Naja, zum Teil. Zu erfliegende Fernreisen sind mir inzwischen ein Greuel. Das umliegende Europa hat mir heute genug zu bieten. Ignoranz? Ich weiß nicht. Ein Jahrzehnt lang habe ich immer wieder in Asien und Afrika gearbeitet in Projekten der internationalen Entwicklungshilfe und die Länder in Teilen, zwecks kultureller Vertiefung, privat noch einmal nachbereist. Erst kürzlich habe ich mit einem backpackenden „Weltreisenden“ gesprochen, total frei auf elterlicher Tasche, der kenntnisreich und durchaus eloquent über Laos mitreden konnte und über Bhutan, aber weder Skandinavien, Frankreich oder Spanien jemals bereist hätte. Ich ahne nicht, warum und wie das manche bewerten und ins Verhältnis setzen.
Mir geht es dabei nicht um eine „gerechtere Umverteilung“, bevor das neoliberale Gezeter der gernegroßen Habenichtse wieder losgeht und schon bestimmt nicht um die gesellschaftliche Entwicklung zu einer Vereinfachung des Alltags, wohinter sich wohl oft der Wunsch verberge, einfach nur weniger zu tun haben zu wollen, um die gewonnene Zeit auf der durchgesessenen Couch mit Netflix zu vertrödeln, wie das eine Trendstudie von „The Future:Project“ aus dem Jahr 2024 im Auftrag von „Siemens Hausgeräte“ herausgefunden haben will. Work-Life-Balance? Betätigungsallergie? Aktivitätsscheue? Lethargischer Exzess. Langzeitprokrastination? Hm.
Im Grunde geht es mir um eine sinnstiftende Gewichtung von Verantwortung und die Reduzierung der unnötigen Ausweitung auf Dinge, deren Handling in keiner Relation steht zu meiner subjektiven Zufriedenheit.
Ich würde inzwischen sogar soweit gehen festzustellen, dass ich zuviele Bücher habe. Das war mir bislang kaum vorstellbar und ist noch ziemlich neu.
Ob ich keine Sehnsüchte kenne? Doch klar! Ruhe und Frieden und das, was mir das schöne Leben ausmacht. Dazu gehören gutes Essen, wirklich gute Weine, aber eben nicht mehrere Dutzend oder gar hunderte Flaschen, ein naturnahes Leben, freier Zugang zu Information per schnellen Internetz, Bücher, Stifte, Papier, meine Leica und wenn es bitte geht, möglichst wenig Störenfriede. Qualitätszeit mit „meinen Menschen“. Da reichen zwei Hände zum Abzählen, oder vielleicht noch die Füße dazu. Kontaktscheu? Nö, aber ich würde gerne Menschenfreund bleiben und mich davon nicht ständig von Menschen abbringen lassen.
Vor zwei oder drei Jahren habe ich während eines unserer regelmäßigen Aufenthalte an der nordjütländischen Westküste, diesmal bei Grønhøj in der Nachbarschaft ein altes Ehepaar kennengelernt. Die erzählten mir, wie sie sich entschieden hatten, aus ihrem großen, komfortablen Haus in Arhus in ein Dünenhäuschen aus Holz von vielleicht einhundert oder einhundertzwanzig Quadratmetern zu ziehen nebst einem stabilen Schuppen als Archiv, Lager und Hauswirtschaftsraum, aber einem spektakulären Blick aufs Meer. Der rüstige Senior, einst ein erfolgreicher Kaufmann berichtete, wie er alle zwei Jahre im Mai begänne, sein Haus von Hand zu streichen und Ende September damit fertig würde. Kein Keller, kein Dachgeschoss, nichts Kompliziertes. Die Witterung und die See erforderten dies und es gäbe seinem Leben einen nachvollziehbaren Rhythmus. Im Gegenzug würde er von der Natur reichlich beschenkt. Für mich steckt darin so viel mehr Sinn als nur Schutzfarbe auf Brettern zu verteilen.
Wenn ich meine 85jährige Mutter frage, was diese sich wünsche, oder was sie brauche, was man ihr schenken könne, dürfe, sagt sie: bitte nichts. Warum? Weil sie schon alles habe und es wieder etwas sei, worum sie sich kümmern müsse, oder was eine Handlung, vielleicht sogar die Aufmerksamkeit einer Retoure verlange. Es wirke ihrer Unabhängigkeit entgegen, schaffe Verbindlichkeiten. Die wenigen Ausnahmen bestätigten diese Regel. Noch vor wenigen Jahren hätte ich mich gefragt, was das wohl solle, was ein Unsinn, und mir selbst wäre adhoc jede Menge Schnickschnack eingefallen, meinen Haushalt augenblicklich zu kontaminieren.
Was würdest du dir anschaffen wollen, wenn du den Jackpot knackst? Ganz sicher keinen albernen Supersportwagen zur idiotischen Ressourcenvernichtung. Vor allem der eigenen. Inzwischen ist mir die mütterliche Philosophie sehr leicht nachvollziehbar.
Ein dänisches Bonmot besagt. „wer mich beschenkte, lehrte mich das Schenken.“
Inzwischen ist mir die Freude am Schenken das eigentliche Geschenk. Man muss dazu auch gar nichts kaufen. In Japan ist es üblich zu sagen, dass ein überreichtes Präsent „tsumaranai mon” sei: „eine uninteressante oder langweilige Sache”. Das soll unterstreichen, dass “die Beziehung zu dem Beschenkten wichtiger sei als der triviale Gegenstand”. Sympathisch. Anstrengend wiederum ist der daraus folgende, nicht enden zu wollen scheinende, rituelle gegenseitige Beschenkungsmarathon. Da sind wir wieder bei den nicht selbst gewählten Pflichten und einer weiteren Verantwortung, die man sich nicht ausgesucht hat. Und das fühlt sich irgendwie übergriffig an. Finde ich.
„Ich weiß gar nicht, was ich dir schenken soll, du hast doch schon alles, oder kaufst es dir selbst nach Bedarf.“ Ist das ein Vorwurf? Oder die Beschreibung von Zufriedenheit ohne Neid und Missgunst auf den Besitz anderer, die halt nur mehr Kram angehäuft haben?
Entrümpeln ist ein Gewinn an Freiheit. Und das heisst ganz sicher nicht, ein Leben ohne jeden irdischen Besitz anzustreben. Es gibt mehr als die leeren Taschen eines Bettelmönchs oder die 400 Milliarden eines Elon Musk, den ich nicht nur für die abersinnige Konzentration von Besitz nicht bewundern kann. Verachte? Quatsch, es geht auch mal kleiner, ohne Empörung. Es ist wohl daran, ein eigenes Maß zu finden und dabei acht zu geben, sich nicht an die Gier zu verschwenden.