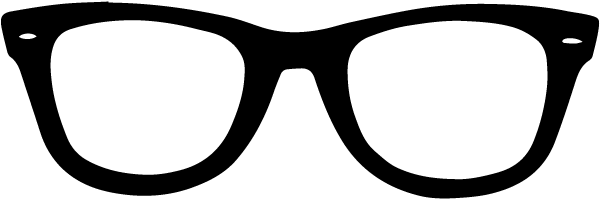Von Synonymen..
Gemäß Duden handelt es sich bei Synonymen um bedeutungsgleiche oder -ähnliche Wörter und Wortgruppen, die in unterschiedlichen Kontexten ausgetauscht werden können, ohne die Aussage entscheidend zu verändern.
Vor ein paar Tagen war das auch ein Thema einer spannenden Diskussion im Podcast meines Freundes Andreas Rolle für sein Format „Lust auf Wiesbaden!“ anlässlich meines frisch erschienenen, vierbändigen Buchzyklus „Seismographien“, worin es unter anderem um einen Ausdruck von Sprachreichtum ging, der sich auch am Fundus ebensolcher Synonyme bemesse. Mein Einwand, dass der quantitative Ansatz möglicherweise Bildungswortschatzblendern gefallen möge, aber keine Aussage treffe über die Qualität einer semantischen Deckungsgleiche führte meinen Gastgeber und mich in ein angeregtes Gespräch über die Möglichkeiten von Sprache, durch herausgearbeitete Nuancen auch feinere Vergleiche anzustellen, was eine konkretere gedankliche Auseinandersetzung bewirken könne. Je präziser ich also etwas im Prozess beschreiben kann, desto klarer kann ich meine Position beziehen. Erstrecht im Prozess.
Klingt komplizierter als es ist.
Nur wenige Tage später stolpere ich im professionellen „Umfeld“ über eine praktische Veranschaulichung des Themas:
„Dilettant“ versus „Amateur“.
Die Wörterbücher greifen die Begriffe im Abgleich nahezu synonym: „Dilettant“ stammt aus dem Lateinischen „delectare“ für „erfreuen“, „sich erfreuen“ oder „erfreut werden“. „Amateur“ von „amator“ für „Liebhaber“, also jemand, der sich mit Herzblut einer Sache widmet.
Beide beschäftigen sich mit einem Handwerk, einer Kunst oder einer Wissenschaft ohne schulische oder berufliche Vorkenntnisse. Ohne Prüfung, ohne Leistungsnachweis, ohne jeden Beleg ihrer tatsächlichen Sachkompetenz. Den zahllosen, begrenzt weitsichtigen Fans solcher Bildungsbiographien, in denen die „school of hard knox“ als ultimativer Universalstandard deliriert wird, mag das genügen. Spätestens im Hinblick auf einen kardiologischen Eingriff erschließen sich vermutlich aber selbst den mäßiger Reflexionsbegabten erste Zweifel. Und nein, es ist kein Zufall, dass Deutschland früher mal für die Ansprüche in Bildung und Ausbildung in aller Welt bewundert wurde. Was sollte man auch machen in Ermangelung anderer Ressourcen? Egal, diese einstige Burg dürfen wir inzwischen wohl getrost als geschleift betrachten. Der Triumph des Banalen.
Zurück zu „Dilettant“ und „Amateur“. Beide üben ihre Sache qua definitionem aus Interesse, Vergnügen oder Leidenschaft aus. Worin liegt also der Unterschied? Möglicherweise darin, dass der Amateur es zumindest zunächst exklusiv um der Sache selbst willen macht, der Dilettant aber daran doch zeitnah irgendwie profitieren möchte, den Experten simuliert, sich damit ins Verhältnis zum formal ausgebildeten Fachmann setzt und es sich eben auch gefallen lassen muss, an diesem gemessen zu werden. Das kann gut gehen. Von Fall zu Fall. Bewerten muss das dann wohl jeder selbst.
Friedrich Schiller meinte, „der Dilettant nehme das Dunkle für das Tiefe, das Wilde für das Kräftige, das Unbestimmte für das Unendliche, das Sinnlose für das Uebersinnliche.“ Das trifft es ziemlich gut, finde ich und sekundiert meiner Theorie, „Dilettanten können Dinge erklären, die sie nicht zu begreifen vermögen.“
Und dann sind da ja auch noch weitere, mal synonymisierende und mal klassifizierendere Begriffe wie Laie, Autodidakt, Nichtfachmann, Flickschuster, Patzer, Stümper, Pfuscher, Nichtskönner oder Blender bis hin zum "Dunning-Kruger-Effekt". Eine Skala. Eine Feinabstufung, die belegt, was es bedeuten kann, die Dinge genauer zu bedeuten, während man sie betrachtet, bedenkt und besinnt. Gerne auch mal im Verhältnis zu sich selbst.
Einer meiner Lieblingssprüche ist ja immer „ich weiß, was ich für ein Innenarchitekt bin, also ahne ich, was du für ein Arzt, Jurist, Architekt, Ingenieur, Handwerker oder was auch immer sein kannst“. Und immerhin habe ich vor gefühlten hundert Jahren mal einen Diplom Ingenieur darin gemacht, möchte mich dabei aber durchaus immer wieder nüchtern selbst einmessen.
In jedem Fall ist es so, dass ich je mehr ich lerne auch ahnen kann, wie wenig ich wirklich weiß: "scio nescio" ... das Wissensparadoxon.
Wie macht Ihr das eigentlich?